Wissen
Gefühlstief statt Babyglück: Wenn Mütter depressiv werden
Manche Mütter fühlen sich nach der Geburt alles andere als glücklich. Das ist nicht ungewöhnlich. Ein Baby bringt viele Veränderungen mit sich – kein Wunder, dass das oft nicht ganz reibungslos vonstatten geht. Was aber unterscheidet den „Baby Blues“ von einer postpartalen Depression?
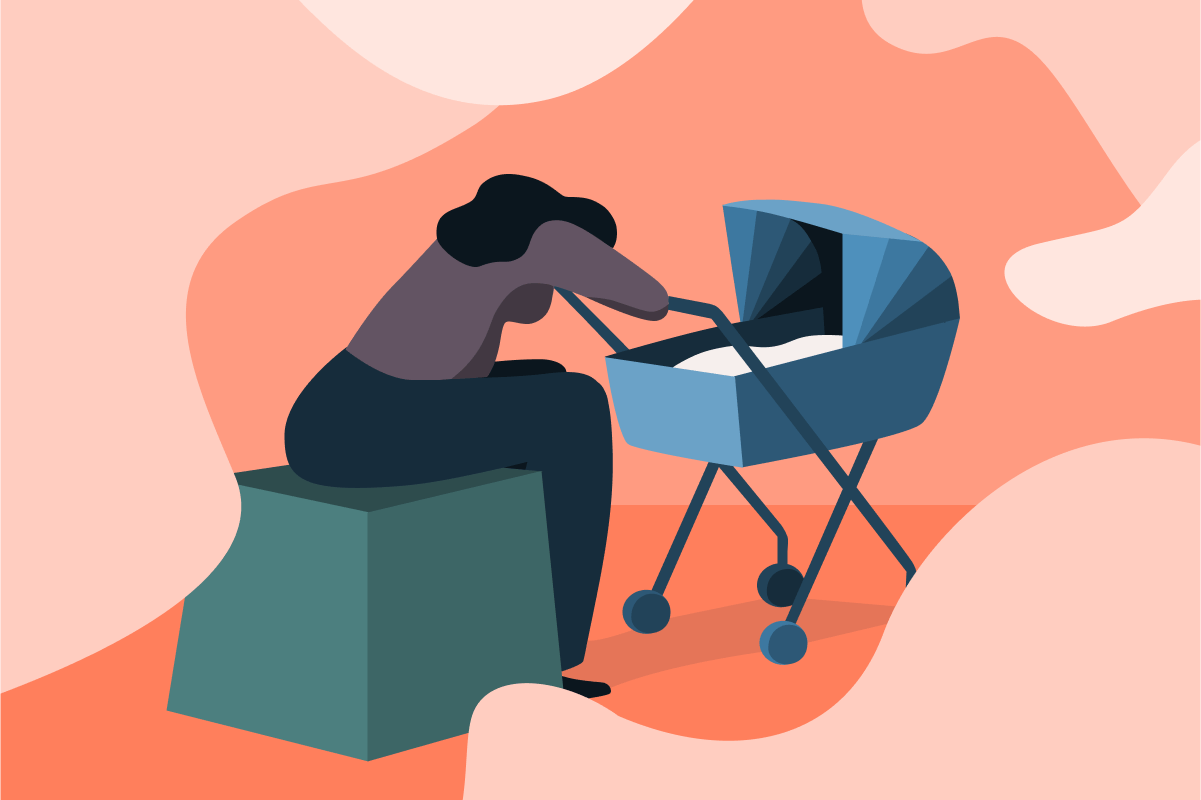
Stimmungsschwankungen nach der Geburt
Viele Eltern beschreiben die Geburt eines Kindes als den „glücklichsten Moment ihres Lebens“. In ihren guten Wünschen und Ratschlägen teilen andere den frischgebackenen Müttern (und auch den Vätern) oft mit, was sie in dieser Situation zu fühlen haben. Aber jede Mutter muss ihre ganz persönliche Form von Mütterlichkeit erst kennen lernen – und das wird gern ignoriert. Ein unerfüllbares Mutter-Ideal ist einer von vielen Gründen dafür, warum der sogenannte Baby Blues und erst recht die Wochenbettdepression lange tabu waren.
Eine Geburt bedeutet Schwerstarbeit für Körper und Psyche. Der damit verbundene Stress und der unausweichliche Schlafmangel der folgenden Tage und Wochen macht emotional verletzlich und die meisten Mütter fallen danach in ein mehr oder weniger ausgeprägtes Stimmungstief: Der Baby Blues, teilweise auch schlicht als die „Heultage“ bezeichnet, betrifft fast drei von vier Müttern.
Heftige Veränderungen in den Hormonen nach der Geburt tun ihr Übriges und sorgen dafür, dass der Blues nach etwa drei bis fünf Tagen einsetzt. Er äußert sich durch starke Stimmungsschwankungen, Empfindsamkeit, häufiges Weinen, Ängstlichkeit, starke Erschöpfung sowie Störungen in Konzentration, Appetit und Schlaf. Dieses Tief kann wenige Stunden bis zu einigen Tagen anhalten. Meist klingt es von selbst wieder ab und muss nicht behandelt werden.
Vom Baby Blues zur Wochenbettdepression
Klingt das Tief nicht innerhalb von zwei Wochen ab, kann es sich um den Beginn einer Wochenbettdepression handeln. Wie bei jeder anderen depressiven Episode muss eine gewisse Anzahl an Symptomen über einen Zeitraum von mindestens vierzehn Tage vorliegen. Anders als die Bezeichnung „Wochenbettdepression“ andeutet, kann sich die Erkrankung bis zu zwölf Monate nach der Geburt entwickeln. Etwa zehn bis zwanzig Prozent der Mütter erkranken daran. Damit ist die Wochenbettdepression die mit Abstand häufigste psychische Erkrankung nach der Geburt.
Was oft verkannt wird: Eine Geburt ist auch für Männer ein Risikofaktor für eine Depression. Etwa vier Prozent der Väter erleben nach der Geburt ihres Kindes in eine depressive Episode. Ursachen dafür sind nicht Hormonschwankungen, sondern vielmehr die neue Herausforderung.
Das bisherige Leben und die Paarbeziehung verändern sich zwangsläufig. Viele Männer sehen sich durch die Vaterschaft mit einem neuen Erwartungsdruck konfrontiert. Außerdem kann es vorkommen, dass sie sich aufgrund der anfangs meist engeren Beziehung zwischen Mutter und Kind ausgeschlossen fühlen.
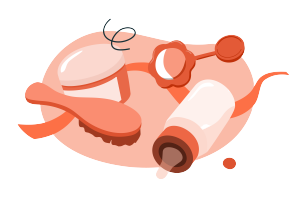
Widersprüchliche Gefühle gegenüber dem Baby
Kennzeichen der Wochenbettdepression sind die üblichen Beschwerden einer Depression wie Energiemangel, Traurigkeit, innere Leere, Schuldgefühle, extreme Reizbarkeit, Desinteresse, Teilnahmslosigkeit, Ängste und Konzentrationsstörungen. Zur Hoffnungslosigkeit reihen sich bei einer Wochenbettdepression widersprüchliche Gefühle gegenüber dem Neugeborenen. Das Baby löst nicht nur Zuneigung, sondern auch Gereiztheit, Angst oder Ärger aus. Das kann Schuldgefühle wiederum verstärken. Betroffene sind oft sehr streng mit sich selbst und glauben, mit dem Kind nicht liebevoll genug umzugehen.
Babys hören manchmal einfach nicht auf zu schreien, ein wahrer Belastungstest, auch für die Nerven der geduldigsten Eltern. Der Schlafmangel, an den sich junge Eltern zunächst gewöhnen müssen, kann die Symptome zusätzlich verschlimmern. Häufig erleben Betroffene der Wochenbettdepression Zwangsgedanken, die sich mitunter in Tötungsgedanken gegenüber sich selbst oder dem Baby äußern können. Diese Gedanken und Gefühle sind für Betroffene extrem belastend. Sie überhäufen sich mit Vorwürfen und schämen sich oftmals, über ihre Symptome zu sprechen. Gleichzeitig sind Betroffene meist über alle Maßen ängstlich in Bezug auf das Wohlergehen des Babys. Es kann sogar zu Panikattacken kommen. Manchmal (in 1-3 von 1000 Fällen) treten bei Müttern nach der Geburt eines Kindes auch psychotische Symptome auf.
Risikofaktoren für eine Wochenbettdepression
Aufgrund der radikalen Lebensveränderung und der akuten Belastungssituation während und nach einer Geburt kann eine Wochenbettdepression jede Mutter treffen. Dennoch gibt es bestimmte Faktoren, die das Risiko erhöhen.
Nach einer Geburt ist eine Frau erschöpft, kann sich aber in der Regel nicht ausruhen, weil die Bedürfnisse des Babys an erster Stelle stehen. Dazu kommen körperliche Veränderungen – Bauch, Brüste und Stoffwechsel verändern sich schlagartig. Außerdem spielen die Hormone verrückt: Progesteron- und Östrogenspiegel fallen plötzlich ab, was depressive Stimmungen und Schlafstörungen begünstigen kann.
Frauen, die an prämenstruellen Stimmungsschwankungen leiden, sowie Frauen mit Schilddrüsen-Unterfunktion haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, nach einer Geburt eine depressive Episode zu erleiden. Auch wenn früher oder bei Familienangehörigen bereits psychische Erkrankungen vorlagen, ist das Risiko höher.
Psychische und psychosoziale Ursachen
Stress, Versagensängste und unerfüllte, oft übertriebene Erwartungen an das Eltern-Dasein können die Depression begünstigen. Ein starres Mutter-Ideal ist nicht hilfreich für den Aufbau einer entspannten Beziehung zum Baby.
Erwartungen der Mütter an sich selbst und Erwartungen anderer können einen hohen Leistungsdruck aufbauen. Frauen fühlen sich diesen Erwartungen häufig nicht gewachsen, können sich mit dem Bild der glücklichen, perfekten Mutter nicht identifizieren – und machen sich dafür Vorwürfe. Wenn eine natürliche Geburt oder das Stillen nicht funktionieren, glauben manche Frauen, in ihrer Rolle als Mutter zu versagen. Besonders gefährdet sind Frauen, die ohnehin sehr perfektionistisch sind oder gern alles unter Kontrolle haben, denn beides ist mit einem Neugeborenen im Haus schwer.
Die neue gesellschaftliche Rolle kann junge Eltern auf einer weiteren Ebene unter Druck setzen: Das Elternwerden wird oft damit verbunden, sich von seiner eigenen Kindheit und Jugend zu verabschieden. Sich selbst nimmt man zurück, die Zeit der Partys ist vorbei. Waren junge Eltern dazu noch nicht bereit, fällt es ihnen schwerer, sich in ihre neue Rolle einzufinden.
Wer zuvor berufstätig war, kann die Elternzeit als Isolation wahrnehmen. Eltern, die weiterhin arbeiten, sind dahingegen einer Doppelbelastung ausgesetzt: Auf der Arbeit müssen sie trotz Schlafmangel funktionieren, zu Hause sind sie erschöpft und stehen den Bedürfnissen eines kleines Lebewesens gegenüber, das sie zunächst einmal kennen lernen müssen.
Vorbeuge durch Vorbereitung
Viele Einflüsse spielen eine Rolle dabei, ob eine Mutter oder ein Vater nach der Geburt ihres Kindes in ein Loch fallen: Ist man gerne Mutter oder Vater geworden? Hat man sich ausreichend auf die Geburt und die darauf folgende Zeit vorbereitet? Erfährt man genug Unterstützung vom Partner und aus dem Umfeld oder fühlt man sich mit der neuen Aufgabe allein gelassen? Hat man als Paar ausreichend besprochen, wer welche Aufgaben übernimmt, oder verfällt man automatisch in Rollen, die man so nie wollte?
Wenn ein ganz gewöhnlicher Baby Blues nicht mehr abklingt oder wenn sich auch eine Weile nach der Geburt das Gefühl von Niedergeschlagenheit und Gefühlslosigkeit einstellt, sollten Alarmglocken klingeln: Eine Wochenbettdepression kommt viel häufiger vor als man denkt, bleibt jedoch leider oft unerkannt. Für die depressive Stimmung muss sich niemand schämen. Im Gegenteil: Eine Wochenbettdepression ist eine durch starke Veränderungen bedingte Erkrankung, die bei jeder Frau auftreten kann. Und je früher die Krankheit erkannt wird, desto schneller und besser lässt sie sich behandeln.
Eine Behandlung kann helfen
Eine Wochenbettdepression hat nichts damit zu tun, dass die Mutter ihr Kind nicht liebt. Vielmehr ist der Zugang zu ihren Gefühlen blockiert. Bei einer Behandlung geht es darum, diesen wieder herzustellen. Eine medikamentöse Therapie kann zudem helfen, das neurobiologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Wenn sich die betroffene Mutter – oder auch der betroffene Vater – besser fühlt, wirkt sich das letztendlich positiv auf die Beziehung zum Kind, aber auch auf die Partnerschaft aus.
Allein in Deutschland sind jedes Jahr etwa 100.000 Mütter von einer psychischen Krise betroffen. Der Verein „Schatten und Licht e.V.” ist eine Selbsthilfe-Organisation zu psychischen Erkrankungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt. Die Website bietet viele weiterführende Informationen und ein Forum: https://www.schatten-und-licht.de

Online-Therapie
Keine Wartezeit, flexible Abendtermine, professionelle Psychotherapeut:innen.

Die MindDoc App
Dein Begleiter im Umgang mit deiner emotionalen Gesundheit.

People Pleasing – wenn die Angst vor Ablehnung zur Falle wird
Es immer allen anderen recht machen und bloß nicht missfallen – das ist das oberste Ziel beim People Pleasing. Dahinter verbirgt sich oft die Suche nach Anerkennung oder eine große Angst vor Ablehnung. In diesem Artikel erfährst du mehr dazu.

Psychische Bedürfnisse am Arbeitsplatz: Wie du sie erfüllen kannst
Stress, Konflikte und Leistungsdruck prägen den Arbeitsalltag vieler Menschen. Wie stark sie belasten, hängt davon ab, ob wichtige psychische Bedürfnisse bei der Arbeit erfüllt werden. Welche das sind und wie sie gestärkt werden können, erfährst du hier.

Hochfunktionale Depression: Das verborgene Leid
Beim Stichwort Depression denken die meisten Menschen an starke Traurigkeit, wenig Energie, sozialen Rückzug oder Schwierigkeiten aus dem Bett zu kommen und den Alltag zu bewältigen. Doch nicht immer trifft das so zu.

Zwangsstörungen: Wenn die eigenen Gedanken oder Handlungen zur Qual werden
Bei einer Zwangsstörung nehmen aufdringliche Gedanken und Handlungen viel Raum und Zeit im täglichen Leben ein und verursachen oft enormen Leidensdruck. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, was Zwangsgedanken und Zwangshandlungen ausmacht und wie sie behandelt werden können.

Dein nächster Schritt: Ein diagnostisches Erstgespräch an einem unserer Standorte
Eine niedergelassene psychotherapeutische Fachperson bespricht mit dir im Erstgespräch, ob eine Online-Psychotherapie für dich das Richtige ist, klärt dich über Alternativen auf und beantwortet dir alle Fragen zum Ablauf.
Kommt eine Therapie für dich in Frage?
Beantworte 15 Fragen um eine erste Einschätzung dafür zu bekommen.