Wissen
Depression bei Männern – Same same but different?
Depression ist eine Frauenkrankheit. So das gängige Vorurteil. Kommen bei der „Männer-Depression“ unsere Vorstellungswelten an ihre Grenzen? Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Depressionen sind angeblich weiblich. Frauen sind doppelt so häufig wegen einer Depression in Behandlung wie Männer.
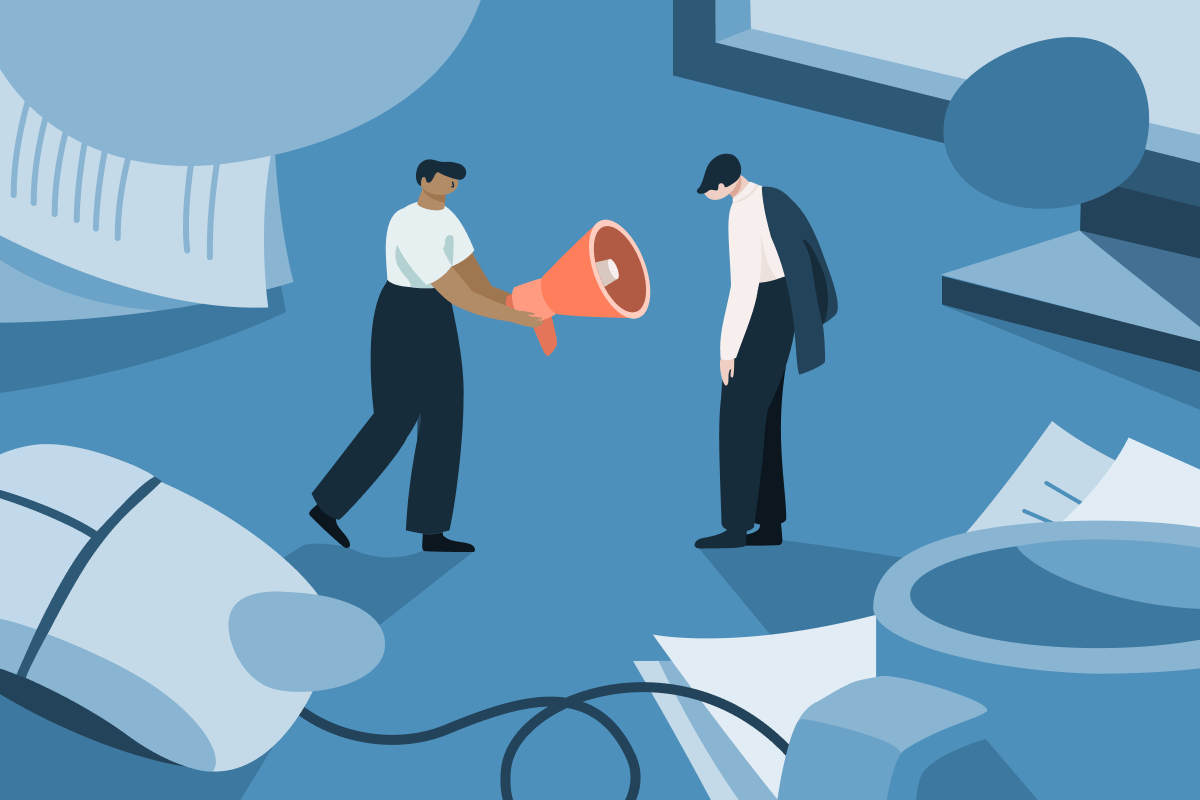
Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Depressionen sind angeblich weiblich. Frauen sind doppelt so häufig wegen einer Depression in Behandlung wie Männer. Das mag zunächst nicht verwundern – werden beim Stichwort „Depression“ doch bei vielen Menschen zunächst Bilder weinender Frauen aktiviert. An anderer Stelle wiederum geraten die Zahlen ins Ungleichgewicht. Verglichen mit Frauen nehmen sich dreimal so viele Männer das Leben. Experten schätzen, dass bis zu 70 Prozent der Suizide auf Depressionen zurückzuführen sind. Das zeigt vor allem eines – den enormen Handlungsbedarf bei Männern mit Depression.
Traurige Tabubrüche: Männliche Suizide
Öffentliche Beachtung fand das Thema männliche Depression vor allem aufgrund tragischer Suizide von Prominenten. Die Suizide von Robert Enke im Jahr 2009, Robin Williams 2014 und Chester Bennington 2017 erfüllten nicht nur Fans mit Betroffenheit und Entsetzen. Offensichtlich war niemand darauf vorbereitet – auch wenn Robert Enke aus seiner Depression nie ein Geheimnis gemacht hatte. Dass eine depressive Erkrankung nicht zu unterschätzen ist, ist inzwischen bekannt. Immerhin hat der Nachhall der tragischen Tode nicht nur negative Auswirkungen. Ein etabliertes Tabu gerät ins Wanken – über die Krankheit Depression wird jetzt gesprochen, auch bei, mit und unter Männern.
Depression bei Frau und Mann – die alte Debatte über Natur und Kultur
Ist es tatsächlich so, dass Frauen so viel häufiger an Depressionen leiden als Männer? Sprechen die Statistiken die Wahrheit? Falls ja, wie lassen sich die Unterschiede erklären? Sind sie biologisch bedingt?
Depression und Biologie
Tatsache: Beim Thema Depression ist die Biologie bisweilen auf Männer-Seite. Rein biologisch tragen Frauen ein leicht höheres Risiko. Hormonschwankungen sind ein zentraler Risikofaktor für Depressionen und depressive Verstimmungen. Allein zyklusbedingt ist das Risiko für Frauen daher erhöht. Darüber hinaus gibt es die sogenannte postpartale Depression, die 10 bis 20 Prozent der Frauen nach der Geburt eines Kindes erleiden. Ursachen dafür können hoher Stress und abrupte hormonelle Veränderungen während und infolge der Geburt eines Kindes sein. Dennoch sind diese spezifisch weiblichen Fälle keineswegs in der Lage, das angeblich doppelt so hohe Risiko für Frauen zu erklären.
Depression und Sozialisation
Vielleicht spielt also auch die Kultur eine Rolle. Bedingt die Sozialisation, dass Frauen häufiger an Depression erkranken als Männer? Von Kind auf erlernen und verinnerlichen Jungen und Mädchen unterschiedliche Verhaltensmuster, auch wenn sich diese im Wandel befinden und Unterschiede weniger stark ausgeprägt sind als früher. Sich verletzlich zu zeigen ist immer noch eine Eigenschaft, die eher Mädchen als Jungen zugestanden wird. Jungen müssen hingegen oft schon als Kinder „Stärke“ beweisen.
In der Konsequenz ist das sozial akzeptierte Verhalten von Männern anders als das von Frauen. Stereotype von Mann und Frau prägen sich aus. Das Bild des „starken Mannes“ ist in der Gesellschaft immer noch präsent und nicht nur in den Köpfen von Männern fest verankert. Zu diesem männlichen Stereotyp gehört stressresistent und belastbar zu sein, die Kontrolle und Unabhängigkeit zu bewahren, Gefahren zu bewältigen und damit verbundene Ängste und Leiden nicht wahrzunehmen.
Klassische Depressionsmerkmale wie Niedergeschlagenheit, Klagsamkeit, Grübeln und Selbstzweifel gelten dementsprechend oft als „unmännlich“. Dahingegen ist eine gewisse Portion Ellbogenmentalität und Konkurrenzdenken sozial akzeptiert und wird häufig positiv als Durchsetzungsstärke ausgelegt.
„Ein Mann kennt keinen Schmerz“ – die Macht der Stereotype
Eine ganze Reihe an Forschern zweifelt die deutlichen Geschlechtsunterschiede in den Statistiken zu Depression an. Die sogenannte “Artefakttheorie” besagt, dass die Unterschiede in Bezug auf Depression bei Männern und Frauen künstlich sind. Die Statistiken seien verzerrt und entsprächen nicht der Realität. Schließlich erschweren es geschlechtsbedingte Rollenzuschreibungen dem Mann, sich eine Depression einzugestehen.
Betroffene Männer nehmen depressive Symptome bisweilen nicht als solche wahr, versuchen sie zu ignorieren oder zu überspielen. Außerdem ist das Hilfesuchverhalten anders: Frauen suchen sich schneller und bereits in früheren Stadien der Depression Hilfe, während viele Männer erst zum Arzt gehen, wenn die Beschwerden bereits unerträglich sind. Dafür spricht auch, dass sich die Zahlen von Männern und Frauen annähern, je schwerer die depressive Episode ist. Beim Hausarzt, der für viele Patienten die erste Anlaufstelle ist, schildern Männer häufig zunächst körperliche Leiden wie Müdigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Schmerzen oder sexuelle Probleme.
Tapfer hält sich die „Ein-Mann-kennt-keinen-Schmerz“-Mentalität. An Depression zu erkranken bedeutet für Männer oftmals, sich Schwäche einzugestehen. Dieses unterschiedliche Hilfesuchverhalten kann darauf hindeuten, dass die Krankheit Depression beim Mann unterdiagnostiziert ist.
Depressionen werden bei Männern oft verkannt
Doch die Stereotype kommen nicht nur von innen: Nicht nur betroffene Männer selbst haben Schwierigkeiten, Depressionssymptome bei sich zu erkennen. Auch Ärzte und Psychotherapeuten erkennen bei Männern eine Depression oft zu spät.
Da eine depressive Episode häufig mit körperlichen Beschwerden wie Rücken- oder Kopfschmerzen einhergeht, weichen Ärzte oft auf Diagnosen aus, die sich auf den Körper beziehen. Oft versteckt sich auch hinter einer Suchterkrankung eigentlich eine Depression: Mehr Männer als Frauen greifen zu Alkohol oder Drogen, um ihre emotionale Verletzlichkeit zu verbergen. Symptome einer Depression werden dadurch übertönt.
In Australien gibt es sogar schon eine Kampagne, die Männer ermuntert, zu weinen, wenn sie traurig sind – mit dem Ziel, größeres Leiden zu verhindern.
Ein eigenes Phänomen: Die „Männer-Depression“
In den letzten Jahren kam in der Wissenschaft zunehmend die Diskussion auf, ob sich eine prototypisch männliche Depression von der „weiblichen Symptomatik“ unterscheidet. Es wurden Forderungen laut, männliche Depression anders zu fassen. Der Begriff „male depression“, „Männer-Depression“, kam ins Leben, als der Psychiater und ehemalige europäische Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Wolfgang Rutz, Anfang der 1990er Jahre auf der schwedischen Insel Gotland ein Präventionsprogramm startete, um die Suizidrate Betroffener von Depression zu senken. Während das Programm die Rate bei Frauen um 90 Prozent senken konnte, blieb die Anzahl der Suizide bei Männern unverändert.
Daraufhin formulierten Rutz und sein Team das Konzept der „Männer-Depression“ und entwickelten die „Gotland Scale of Male Depression“, ein Screening-Tool, um Depressionen bei Männern besser zu erkennen. In einem zweiten Teil der Studie wurden neben den klassischen Depressionskriterien außerdem sozialer Rückzug, geringe Impulskontrolle, antisoziales Verhalten und Aggressivität als Risikofaktoren für Suizid betrachtet. In diesem zweiten Teil konnten die depressiven Männer erfasst und infolgedessen die Anzahl der männlichen Suizide verringert werden.
Die „Männer-Depression” ist nicht immer spezifisch
Einig sind sich die Fachleute nicht, ob eine Unterscheidung in geschlechtsbedingte Ausprägungen sinnvoll ist. Wer das Konzept der Männer-Depression vertritt, geht davon aus, dass sich eine Depression bei Männern anders äußern kann als bei Frauen. Das gilt natürlich nicht pauschal für alle Männer, und gleichzeitig gibt es auch Frauen, deren depressive Symptome eher auf die „maskuline“ Seite des Spektrums fallen.
Zentral ist in diesem Zusammenhang außerdem, dass das Phänomen der maskulinen Depression kein Gegenkonzept zur üblichen Depression darstellt. Vielmehr ist es dazu gedacht, neben den herkömmlichen Symptomen für weitere Merkmale zu sensibilisieren, hinter denen sich eine Depression verstecken kann.
Bei der „Männer-Depression“ treten Symptome oft maskiert auf
Übliche Depressionssymptome wie innere Leere, gedrückte Stimmung und Suizidgedanken bleiben nach wie vor zentrale Leiden einer Depression – nur mit dem Zusatz, dass viele Männer einen leichteren Zugang zu anderen Beschwerden finden, die ihr soziales Rollenbild weniger gefährden. Die Unterschiede gehen auf ein prototypisches Rollenbild zurück und nicht auf biologische Unterschiede, und sind somit veränderbar und keineswegs pauschal gültig.
Laut Verfechtern der “male depression” geht die depressive Stimmung bei Männern öfters als bei Frauen mit einer erhöhten Reizbarkeit einher. Während die meisten Frauen bei Traurigkeit eher in sich hineinhorchen, neigen viele Männer verstärkt zum „Externalisieren“, so die Vertreter der “Männer-Depression”. Betroffenen fällt es schwerer als vorher, Impulse zu kontrollieren, die Stress-Grenze ist schneller erreicht.
Ein Relikt aus der Evolution: Unterschiedliches Verhalten bei Stress
Verstärkt aggressive Abwehrreaktionen können ein Hinweis darauf sein, dass man droht, in eine depressive Episode zu rutschen. In der Evolutionspsychologie spricht man auch vom sogenannten “fight or flight” Muster, mit dem insbesondere Männer auf Stress reagieren: Man kämpft oder entflieht der Situation. Evolutionär und sozialisationsbedingt reagieren Frauen eher mit einem Muster, das als “tend and befriend” bezeichnet wird: behüten und beschwichtigen. Es macht Sinn: Mit Nachwuchs auf dem Arm kämpft oder flieht es sich nun einmal nicht so schnell wie ohne. Verallgemeinern kann man das natürlich nicht, zumal Rollenbilder aufbrechen und Männer wie Frauen beide Reaktionsweisen benötigen, um erfolgreich zu sein.
Es kommt zu typischen Abwehrmechanismen wie sozialem Rückzug, der gleichzeitig abgestritten wird. Depressive Männer haben oft verstärkt das Bedürfnis, in Ruhe gelassen zu werden. Kummer und Niedergeschlagenheit tragen sie nicht nach außen, sie versuchen ihr Leiden vielmehr zu verstecken, um sich keine Hilflosigkeit einzugestehen. Charakteristisch für die „male depression“ ist eine erhöhte Kränkbarkeit. Kritik wird schneller als sonst persönlich genommen, weil man sich dadurch schneller bedroht fühlt. Gleichzeitig neigen Menschen mit Männer-Depression verstärkt dazu, sehr streng mit sich selbst zu sein. Schon wegen Kleinigkeiten machen sie sich Vorwürfe, haben Angst zu versagen. Die maskuline Depression kennzeichnet außerdem starke innere Unruhe. Die Konzentration lässt nach, man bekommt Schlafprobleme.
Viele Männer greifen verstärkt zu Alkohol, Zigaretten, aber auch zu exzessiver Arbeit, exzessivem Sport oder Fernsehkonsum. Das selbstschädigende Verhalten kann im Extremfall in Suizid münden – bei depressiven Männern öfters als bei depressiven Frauen. Zwar ist bei Frauen die Rate der Suizidversuche höher, doch Männer wählen die gewalttätigen Formen, sodass es doppelt so viele Suizide von depressiven Männern gibt als von Frauen.
Soziologische Forschungen haben sich neben dem klinischen Bild auch mit abweichenden Risikofaktoren beschäftigt. So sind Männer laut Anne-Maria Möller-Leimkühler, Professorin für Medizinische Soziologie, „besonders anfällig für Stressoren, die ihren sozialen Status bedrohen“. Während Frauen auf unterschiedlichen Ebenen Risikofaktoren begegnen, ist die Berufsrolle für Männer die übergeordnete Stressquelle. Anders als noch vor einer oder zwei Generationen gibt es allerdings auch immer mehr Frauen, die sich hauptsächlich über ihren Beruf – und weniger über Familie oder freundschaftliche Beziehungen – definieren.
Dieser Wandel im Rollenbild der Frau zeigt vor allem eines: Selbstverständlich sind die unterschiedlichen Risikofaktoren nicht in Stein gemeißelt, sondern gehen auf die Sozialisation und daraus entsprungene unterschiedliche Rollenbilder zurück. Je mehr sich die sozialen Rollen von Mann und Frau angleichen, desto mehr werden sich auch die Risikofaktoren ähneln. Wenn der sozioökomische Status einer Familie auf die Frau genauso wie auf den Mann zurückgeführt wird und es gesellschaftlich genauso akzeptiert ist, Hausmann wie Hausfrau zu sein, dann wird eine separate Betrachtung von Depression bei Männern und Frauen höchstwahrscheinlich überflüssig. In der Konsequenz bedeutet das, dass das Phänomen einer “Männer-Depression” ein vorübergehendes Konstrukt ist und eine solche Unterscheidung vielleicht irgendwann nicht mehr nötig sein wird.
Depression beim Mann – Raus aus der Tabuzone
Selbstverständlich bedeutet die spezifische „Männer-Depression“ nicht, dass die üblichen Depressionssymptome auf Männer gar nicht zutreffen. Ohne Zweifel gelten die üblichen Symptome einer Depression für Mann und Frau. Doch bei Männern treten die Leitsymptome häufig maskiert auf. Gerade weil die Vermutung naheliegt, dass Männer unterdiagnostiziert und in den Statistiken unterrepräsentiert sind, werden in Fachkreisen Forderungen laut, den Symptomkatalog von Depression um Männer-typische Beschwerden zu erweitern. Das Ziel ist, Depression bei Männern besser zu erkennen.
Das Geschlechterparadox bei den Depressions- und Suizidraten macht es deutlich: Nicht die Depression, sondern die Statistik ist weiblich. Gleichzeitig erfordert die Depression bei Männern mehr Aufmerksamkeit. Müdigkeit, Gereiztheit, Workaholismus, exzessiver Alkohol, Rücken- und Kopfschmerzen – gerade weil sich eine Depression bei Männern oft zunächst anhand körperlicher Symptome zeigt, sollten bei Ärzten bei derartigen Schilderungen die Alarmglocken klingeln. Das Thema Depression bei Männern muss aus der Tabuzone hervorgeholt werden, um Erkrankungen früher zu erkennen und in letzter Konsequenz Suizide zu verhindern. Ein allzu starres Männlichkeitsideal kann dabei nur hinderlich sein.

Online-Therapie
Keine Wartezeit, flexible Abendtermine, professionelle Psychotherapeut:innen.

Die MindDoc App
Dein Begleiter im Umgang mit deiner emotionalen Gesundheit.

People Pleasing – wenn die Angst vor Ablehnung zur Falle wird
Es immer allen anderen recht machen und bloß nicht missfallen – das ist das oberste Ziel beim People Pleasing. Dahinter verbirgt sich oft die Suche nach Anerkennung oder eine große Angst vor Ablehnung. In diesem Artikel erfährst du mehr dazu.

Psychische Bedürfnisse am Arbeitsplatz: Wie du sie erfüllen kannst
Stress, Konflikte und Leistungsdruck prägen den Arbeitsalltag vieler Menschen. Wie stark sie belasten, hängt davon ab, ob wichtige psychische Bedürfnisse bei der Arbeit erfüllt werden. Welche das sind und wie sie gestärkt werden können, erfährst du hier.

Hochfunktionale Depression: Das verborgene Leid
Beim Stichwort Depression denken die meisten Menschen an starke Traurigkeit, wenig Energie, sozialen Rückzug oder Schwierigkeiten aus dem Bett zu kommen und den Alltag zu bewältigen. Doch nicht immer trifft das so zu.

Zwangsstörungen: Wenn die eigenen Gedanken oder Handlungen zur Qual werden
Bei einer Zwangsstörung nehmen aufdringliche Gedanken und Handlungen viel Raum und Zeit im täglichen Leben ein und verursachen oft enormen Leidensdruck. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, was Zwangsgedanken und Zwangshandlungen ausmacht und wie sie behandelt werden können.

Dein nächster Schritt: Ein diagnostisches Erstgespräch an einem unserer Standorte
Eine niedergelassene psychotherapeutische Fachperson bespricht mit dir im Erstgespräch, ob eine Online-Psychotherapie für dich das Richtige ist, klärt dich über Alternativen auf und beantwortet dir alle Fragen zum Ablauf.
Kommt eine Therapie für dich in Frage?
Beantworte 15 Fragen um eine erste Einschätzung dafür zu bekommen.